Manchmal ist es nicht die Welt da draußen, die uns am meisten stresst – sondern der Mensch, den wir lieben.
In Beziehungen, in denen einer oder beide Partner mit einer Persönlichkeitsstörung leben – etwa Borderline oder Narzissmus –, kann Nähe schnell zu einem Pulverfass werden. Worte, Gesten oder sogar Schweigen können plötzlich zu Triggern werden. Und was ursprünglich als Gespräch begann, endet in Rückzug, Wut, Tränen oder Schweigen.
Dieser Artikel erklärt, warum das so ist, wie diese Trigger entstehen und welche konkreten Kommunikationsstrategien helfen, Konflikte zu entschärfen, bevor sie eskalieren.
1. Was bedeutet es, wenn ein Partner zum Trigger wird?
Ein „Trigger“ ist ein Auslöser – etwas, das eine starke emotionale Reaktion hervorruft.
Für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) können das zum Beispiel sein:
- Ein bestimmter Tonfall („Du bist schon wieder so empfindlich“)
- Ignoranz oder Schweigen im Streit
- Veränderungen in Nähe oder Aufmerksamkeit („Warum hast du gestern weniger geschrieben?“)
- Kritik, auch wenn sie sachlich gemeint ist
Für narzisstische Persönlichkeitszüge oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) wirken andere Dinge als Trigger:
- Wahrgenommene Kränkungen oder Zurückweisungen
- Verlust von Kontrolle oder Bewunderung
- Situationen, in denen das eigene Bild bedroht wird („Ich bin nicht gut genug“ → Wut oder Rückzug)
- Kritik, die das Selbstwertgefühl angreift
Beide Störungen – Borderline und Narzissmus – haben eines gemeinsam:
Sie reagieren auf emotionale Unsicherheit mit Überkompensation.
Während Borderline-Betroffene Angst haben, verlassen zu werden, fürchten Narzisstische, ihre Überlegenheit oder Kontrolle zu verlieren.
Beide fühlen sich in Krisen schnell ohnmächtig – und diese Ohnmacht äußert sich oft in Kommunikationsmustern, die den Partner verletzen.
2. Wenn zwei Trigger-Systeme aufeinandertreffen
Ein typisches Beispiel:
Beispiel 1:
Anna (Borderline) fühlt sich von Tom (mit narzisstischen Zügen) nicht gesehen. Sie schreibt ihm:
„Du meldest dich nie von allein, ich bin dir wohl egal.“
Tom reagiert kühl: „Immer dieses Drama, ich hab auch ein Leben.“Anna fühlt sich abgelehnt → zieht sich zurück oder weint → Tom empfindet das als Manipulation → reagiert mit Abwehr oder Spott.
Ein Kreislauf entsteht.
Beide Partner erleben den anderen als „den Auslöser“.
Tatsächlich sind aber beide getriggert – nur auf unterschiedliche Weise.
- Anna durch gefühlte emotionale Distanz
- Tom durch gefühlte Einengung oder Kritik
Der Schlüssel liegt also nicht im Verhalten selbst, sondern in der inneren Bedeutung, die jeder Partner diesem Verhalten gibt.
3. Die häufigsten Kommunikationsfallen
a) Verteidigung statt Verständnis
Wenn einer Kritik hört, reagiert er oft sofort mit Rechtfertigung („Ich hab doch gar nichts gemacht!“).
Dadurch fühlt sich der andere abgewiesen – und wird lauter, emotionaler oder anklagender.
→ Besser: Erst den emotionalen Inhalt wahrnehmen, bevor man reagiert.
Beispiel:
„Du hast recht, das kam vielleicht distanziert rüber. Ich wollte dich aber nicht verletzen.“
b) Schweigen als Schutz
Viele ziehen sich zurück, um Streit zu vermeiden. Für Borderliner kann Schweigen jedoch wie ein emotionaler Todesstoß wirken.
Es wird als Ablehnung empfunden, nicht als Beruhigungsversuch.
→ Alternative: Verbales Schweigen
Beispiel:
„Ich merke, dass ich gerade überfordert bin. Ich brauche 30 Minuten Pause, dann können wir weiterreden.“
c) Emotionale Vergeltung
Wenn einer verletzt wurde, reagiert er mit gleicher Münze:
„Du warst kalt – jetzt bin ich es auch!“
So eskaliert die Spirale.
→ Besser: Verletzung benennen, nicht spiegeln.
Beispiel:
„Ich war verletzt, als du dich zurückgezogen hast. Ich brauche Nähe, nicht Distanz.“
4. Warum Kommunikation mit Borderline- oder narzisstischen Partnern so schwierig ist
Beide Störungsbilder verändern die Wahrnehmung in sozialen Interaktionen.
Ein Satz kann völlig unterschiedlich verstanden werden – je nachdem, durch welchen „Filter“ er gehört wird.
| Situation | Borderline-Filter | Narzissmus-Filter |
|---|---|---|
| Partner ist still | „Er hasst mich, ich bin ihm egal“ | „Ich bin genervt, er will mich kontrollieren“ |
| Kritik | „Ich bin schlecht, nicht liebenswert“ | „Wie kann er es wagen, mich zu kritisieren?“ |
| Rückzug | „Ich bin verlassen“ | „Ich brauche Kontrolle, sonst verliere ich mich“ |
Das bedeutet:
Der gleiche Satz kann bei zwei Menschen völlig unterschiedliche emotionale Explosionen auslösen.
Wer das versteht, kann Konflikte besser einordnen – und gezielter kommunizieren.
5. Die Kunst der Deeskalation: Schritt-für-Schritt
Schritt 1: Trigger erkennen
Jede/r sollte wissen: Was bringt mich aus dem Gleichgewicht?
→ Beispiel: „Wenn du mir nicht antwortest, fühle ich mich wertlos.“
Schritt 2: Trigger mitteilen
Sag deinem Partner klar, was dich trifft – ohne Schuldzuweisung.
→ „Wenn du dich zurückziehst, macht mich das unsicher. Kannst du kurz Bescheid sagen, wenn du Zeit brauchst?“
Schritt 3: Verantwortung übernehmen
Erkenne an, dass dein Gefühl deins ist – der Partner löst es aus, aber verursacht es nicht absichtlich.
→ „Ich weiß, dass das mein altes Muster ist. Ich arbeite daran.“
Schritt 4: Ich-Botschaften statt Du-Angriff
„Du bist immer so kalt“ → Angriff
„Ich fühle mich allein, wenn du still wirst“ → Bedürfnis
Schritt 5: Pausen zulassen
In hitzigen Momenten hilft keine Argumentation.
→ Vereinbart ein Codewort wie „Stopp“ oder „Reset“, um kurz Luft zu holen.
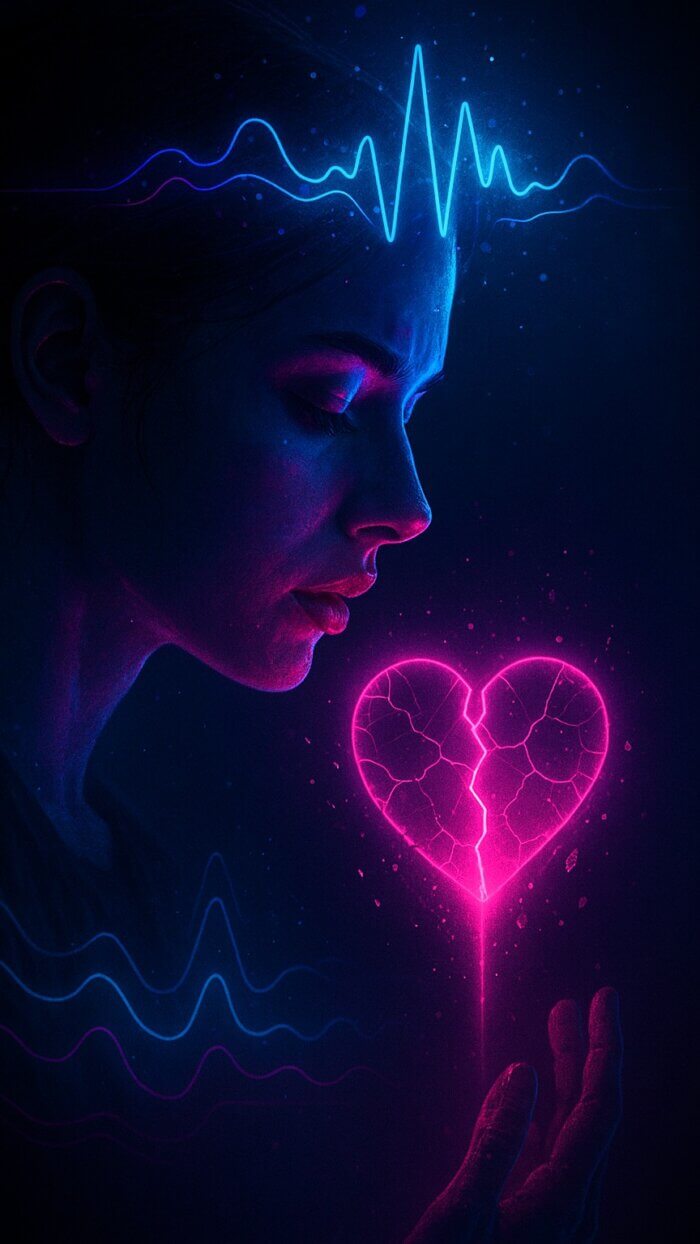
6. Praktische Kommunikationshilfen in Konfliktsituationen
a) Das “3-Minuten-Prinzip”
Beide dürfen maximal 3 Minuten am Stück sprechen – ohne Unterbrechung.
Der andere wiederholt danach kurz, was er verstanden hat.
→ So bleibt der Fokus auf Verständnis, nicht auf Sieg.
b) Das “Protokoll-Gespräch”
Hilfreich bei Paaren mit Impulsivität oder Vergesslichkeit:
Man schreibt während des Gesprächs stichpunktartig mit.
→ Das verhindert, dass nachher jemand sagt: „Das hab ich nie gesagt!“
c) Statt Recht haben: sich gesehen fühlen
Viele Diskussionen drehen sich gar nicht um Fakten, sondern um Gefühle von Wert, Nähe oder Kontrolle.
→ Beispiel:
„Ich weiß, dass du mir nichts Böses wolltest. Aber es hat mich an etwas Altes erinnert.“
d) Selbstregulation üben
Wenn du spürst, dass dein Puls steigt:
- kaltes Wasser über die Hand laufen lassen
- 10 Sekunden tief atmen
- Satz wie: „Ich bin im Hier und Jetzt“ wiederholen
→ Erst danach sprechen.
7. Wenn beide Seiten verletzt sind
In Beziehungen zwischen Borderline- und narzisstischen Anteilen entsteht oft eine emotionale Wechselwirkung:
Der eine sucht Nähe, der andere Abstand.
Der eine will Sicherheit, der andere Kontrolle.
→ Beispiel 2:
Lisa (Borderline): „Warum hast du meine Nachricht gelesen, aber nicht geantwortet?“
Mark (narzisstisch): „Weil ich keine Lust habe, mich ständig zu rechtfertigen.“Lisa weint, Mark geht. Beide fühlen sich unverstanden.
Hier hilft kein Schuldzuweisen, sondern Verständnis für die unterschiedliche Wahrnehmung:
- Lisa braucht emotionale Rückversicherung.
- Mark braucht Raum, um Autonomie zu behalten.
Eine Lösung kann sein:
„Ich sehe, dass du gerade Abstand brauchst. Sag mir bitte, wann du wieder sprechen möchtest – das hilft mir, nicht in Panik zu geraten.“
8. Realistische Erwartungen
Kein Mensch kann dauerhaft triggerfrei kommunizieren.
Das Ziel ist nicht, nie mehr Streit zu haben, sondern schneller zurück zur Verbindung zu finden.
- Kommunikation ist kein Talent, sondern Training.
- Emotionale Sicherheit entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Wiederholung von Respekt.
Satz zum Mitnehmen:
„Wir sind zwei verletzte Menschen, die versuchen, einander nicht an denselben Stellen weh zu tun.“
9. Wann professionelle Hilfe sinnvoll ist
Wenn Konflikte ständig eskalieren, sich Schuldzuweisungen verfestigen oder Gewalt (verbal oder körperlich) auftritt, ist eine Paartherapie oder Einzeltherapie dringend ratsam.
Formen der Hilfe:
- Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) bei Borderline
- Schematherapie oder Verhaltenstherapie bei narzisstischen Mustern
- Paarberatung mit Fokus auf Emotionsregulation
Manchmal reicht schon ein neutraler Dritter, um die Dynamik zu entschärfen.
10. Fazit: Kommunikation als Spiegel der Wunden
Trigger sind keine Feinde – sie zeigen, wo unsere seelischen Narben liegen.
Wenn Partner einander zu Triggern werden, ist das kein Zeichen für Unvereinbarkeit, sondern ein Hinweis auf unheilte Themen.
Wer diese Signale ernst nimmt, kann Beziehung als Wachstumsraum begreifen:
Nicht, um sich gegenseitig zu therapieren, sondern um gemeinsam zu lernen, anders miteinander zu sprechen.
Kommunikation heilt keine Wunden –
aber sie verhindert, dass sie immer wieder aufreißen.
Konkrete Übung zum Schluss:
Schreibt euch gegenseitig 3 Sätze auf:
- Wann ich mich sicher fühle, ist …
- Was mich triggert, ist …
- Was mir in Krisen hilft, ist …
Lest es euch laut vor – nicht um zu diskutieren, sondern um zu verstehen.
Das ist die Basis von Heilung in Beziehungen, in denen Trigger keine Trennung bedeuten müssen – sondern einen Weg zu mehr Bewusstheit.
📚 Weiterführende Lesetipps: Kommunikation, Borderline & Narzissmus
1️⃣ Borderline und Narzissmus – Wie Menschen nach Liebe und Bewunderung streben
🖋 Elinor Greenberg
➡️ Jetzt auf Amazon ansehen
Ein praxisnahes Buch über emotionale Bedürfnisse, Trigger und Beziehungsdynamiken bei Borderline und narzisstischen Mustern. Verbindet Psychologie mit alltagsnahen Beispielen – verständlich und tiefgehend zugleich.
2️⃣ Ist es Narzissmus, Borderline oder bipolar?
🖋 Chelsea D. Lusk
➡️ Jetzt auf Amazon ansehen
Ein klarer, humorvoller Leitfaden zur Unterscheidung und Überschneidung typischer Verhaltensmuster. Ideal, um Trigger-Reaktionen besser zu verstehen und zu lernen, wie Kommunikation nicht im Drama endet.
3️⃣ Wenn lieben weh tut – Kommunikationsratgeber für Partner in Borderline-Beziehungen
🖋 Sabine Mertens
➡️ Jetzt auf Amazon ansehen
Kompakter Ratgeber mit Fokus auf Gesprächstechniken, Grenzsetzung und emotionaler Stabilität in Beziehungen mit Borderline-Beteiligung – konkret, empathisch, hilfreich.
Transparenzhinweis:
Dieser Beitrag enthält ggf. Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links etwas kaufst, erhalten wir eine kleine Provision – ohne Mehrkosten für dich. So unterstützt du direkt die Arbeit an Blog, Podcast und Musik. Vielen Dank.
📘 Glossar: Fachbegriffe einfach erklärt
Trigger
Ein Trigger (engl. „Auslöser“) ist ein Reiz, der eine starke emotionale Reaktion hervorruft – oft, weil er unbewusst an ein früheres Trauma oder eine schmerzhafte Erfahrung erinnert.
Beispiel: Wenn jemand in der Kindheit häufig ignoriert wurde, kann Schweigen des Partners später ein Gefühl von Verlassenheit auslösen.
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS)
Eine psychische Störung, die durch instabile Beziehungen, intensive Emotionen, Impulsivität und starkes Schwarz-Weiß-Denken gekennzeichnet ist.
Menschen mit BPS schwanken oft zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst vor Zurückweisung.
Typisch sind extreme Stimmungsschwankungen, Selbstzweifel und starke Verlustängste.
Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS)
Eine tief verwurzelte Störung des Selbstwertgefühls, die sich durch übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung, Empfindlichkeit gegenüber Kritik und mangelnde Empathie zeigt.
Hinter der Fassade von Stärke oder Arroganz steckt oft ein fragiles Selbstwertgefühl.
Nicht jeder mit „narzisstischen Zügen“ hat automatisch eine NPS – es ist ein Spektrum.
Trigger-System
Bezeichnet die individuellen psychischen Reaktionsmuster, die durch bestimmte Situationen aktiviert werden.
Beispiel: Eine Person, die als Kind oft kritisiert wurde, reagiert auf Kritik als Erwachsener übermäßig stark – auch wenn sie sachlich gemeint ist.
Emotionsregulation
Die Fähigkeit, starke Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu steuern, ohne von ihnen überwältigt zu werden.
Bei Borderline- oder narzisstischen Strukturen ist diese Fähigkeit oft beeinträchtigt – Gefühle kippen schneller und heftiger.
Emotionsregulation kann therapeutisch erlernt werden, etwa durch Achtsamkeit oder DBT.
DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie)
Eine spezielle Form der Verhaltenstherapie, entwickelt von Marsha M. Linehan, die besonders bei Borderline-Persönlichkeitsstörung wirksam ist.
Sie kombiniert Achtsamkeit, Emotionsregulation, Stressbewältigung und zwischenmenschliche Fertigkeiten.
DBT hilft, starke Gefühle zu verstehen, zu benennen und kontrolliert auszudrücken.
Schematherapie
Eine psychotherapeutische Methode, die davon ausgeht, dass wir alle „Lebensschemata“ (Muster aus Kindheitserfahrungen) in uns tragen.
Diese Schemata beeinflussen, wie wir Beziehungen erleben und auf Konflikte reagieren.
Beispiel: Ein „Verlassenheits-Schema“ führt dazu, dass jemand überempfindlich auf Distanz reagiert.
Ich-Botschaften
Eine Kommunikationsform, bei der man eigene Gefühle und Bedürfnisse ausdrückt, statt Vorwürfe zu machen.
Beispiel:
❌ „Du bist immer so kalt!“
✅ „Ich fühle mich allein, wenn du dich zurückziehst.“
Dadurch wird Kommunikation weniger konfrontativ und fördert Verständnis.
Dissoziation
Ein psychologischer Schutzmechanismus, bei dem sich ein Mensch innerlich „abkoppelt“, um zu starke Emotionen oder Stress nicht zu spüren.
Man fühlt sich dann leer, taub oder wie „nicht richtig da“.
Kommt bei Borderline häufig in Extremsituationen vor.
Deeskalation
Strategien, um eine aufgeheizte Situation zu beruhigen.
Dazu gehört z. B. eine Gesprächspause, ein neutraler Tonfall, das Erkennen eigener Trigger oder der bewusste Verzicht auf Schuldzuweisungen.
Ziel: Verbindung statt Verteidigung.
Selbstwahrnehmung
Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse zu erkennen und richtig einzuordnen.
Ohne Selbstwahrnehmung kann Kommunikation schnell in Projektionen kippen („Du bist schuld, dass ich mich schlecht fühle“).
Training durch Reflexion, Tagebuch, Therapie oder Achtsamkeitsübungen.
Schwarz-Weiß-Denken
Ein Denkmuster, das zwischen Extremen schwankt – „alles oder nichts“, „gut oder böse“.
Typisch bei Borderline ist dieses „Splitting“, das Beziehungen instabil macht.
Beispiel: Ein Partner wird zuerst idealisiert („Du bist perfekt!“) und kurz darauf abgewertet („Du bist wie alle anderen!“).
Gaslighting
Ein psychologischer Manipulationsmechanismus, bei dem jemand das Gegenüber an seiner Wahrnehmung zweifeln lässt („Das hast du dir nur eingebildet“).
Kommt häufig in toxischen Beziehungen mit narzisstischen Mustern vor.
Ziel ist, Macht zu behalten und Verantwortung abzuwehren.
Kompensation
Ein psychologischer Mechanismus, bei dem Menschen versuchen, innere Unsicherheiten durch äußeres Verhalten auszugleichen.
Beispiel: Ein Mensch mit geringem Selbstwertgefühl kompensiert das durch Arroganz oder übermäßige Leistungsbereitschaft.
Validierung
Bedeutet: Die Gefühle des anderen ernst nehmen, ohne sie zu bewerten.
Beispiel:
„Ich kann verstehen, dass du dich verletzt fühlst.“
→ Statt: „Jetzt übertreib doch nicht!“
Validierung ist eine Kerntechnik der DBT und entscheidend für vertrauensvolle Kommunikation.
Affekt
Der Affekt beschreibt einen starken, kurzfristigen Gefühlszustand (z. B. Wut, Angst, Scham).
In emotional geladenen Beziehungen können Affekte so intensiv werden, dass rationale Kommunikation kaum möglich ist.
Ziel der Therapie ist, Affekte wahrzunehmen, ohne von ihnen gesteuert zu werden.
Selbstwertregulation
Der innere Mechanismus, mit dem wir unser Selbstbild stabil halten.
Bei narzisstischen Strukturen ist diese Regulation gestört – Anerkennung von außen wird notwendig, um sich „gut“ zu fühlen.
Kritik oder Ablehnung kann dann als existenzielle Bedrohung erlebt werden.
Kohärenz
Das Gefühl von innerer Stimmigkeit – wenn Denken, Fühlen und Handeln zusammenpassen.
Fehlt Kohärenz, entsteht innere Spannung oder Verwirrung.
Kommunikation wird dann oft widersprüchlich oder ambivalent.
Affektive Resonanz
Die Fähigkeit, die Emotionen anderer intuitiv zu spüren und mitzufühlen.
Borderline-Betroffene haben oft eine sehr hohe Resonanzfähigkeit – sie nehmen Spannungen sofort wahr, was gleichzeitig belastend sein kann.
Mentalisierung
Das Vermögen, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer (und sich selbst) zu verstehen.
Fehlt diese Fähigkeit in Konflikten, interpretiert man das Verhalten des Partners falsch.
Beispiel: „Er redet nicht mit mir“ → wird gedeutet als „Er hasst mich“, statt „Er braucht gerade Ruhe“.
Affektive Disregulation
Ein Zustand, in dem Emotionen nicht mehr kontrollierbar sind – sie „überfluten“ den Menschen.
Typisch für akute Borderline-Krisen: Wut, Verzweiflung oder Panik entstehen ohne erkennbaren äußeren Grund.
Therapieallianz
Das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut:in und Klient:in.
Eine stabile Allianz verbessert nachweislich die Heilungschancen – besonders bei Persönlichkeitsstörungen, wo Bindungsunsicherheit ein zentrales Thema ist.
Beziehungsdynamik
Das Zusammenspiel beider Partner in emotionaler, kommunikativer und psychischer Hinsicht.
Bei Borderline–Narzissmus-Konstellationen entsteht oft ein „Tanz zwischen Nähe und Distanz“, der sich gegenseitig verstärkt.
🩶 Fazit zum Glossar
Dieses Glossar soll helfen, komplexe psychologische Begriffe verständlich zu machen, ohne sie zu verflachen. Es kann als Begleittext zu deinem Artikel stehen, damit auch Leser:innen ohne Fachhintergrund die Dynamiken zwischen Borderline, Narzissmus und Kommunikation nachvollziehen können.
Entdecke mehr von LautFunk
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

